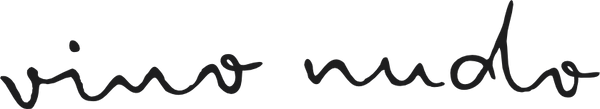Gratisversand innerhalb Österreichs ab € 99
Gratisversand nach Deutschland ab € 120
Versandkosten innerhalb der EU
Zahlungsarten
Veneto – Eine kurze Einführung
Das Veneto ist in vielerlei Hinsicht groß. Neben Sizilien ist es die größte Weinbauregion Italiens. Es veranstaltet die größte Weinmesse des Landes in Verona (Vinitaly) und die größte, ausschließlich Naturweinen gewidmete Veranstaltung in Gambellara (vinnatur). Seinen Kellern entspringt eine immense Menge übelster Industrieplörre und eine genauso beeindruckende Anzahl an hochindividuellen und ausdrucksstarken Weinen. Das Veneto ist in sich äußerst heterogen: Vom Ostufer des Gardasees (Bardolino) bis zur Grenze ans Friaul reihen sich mit dem Bardolino & Valpolicella (ausnahmslos rot), Soave, Gambellara (weiß) und dem Prosecco (Sprudel) gänzlich unterschiedliche Weinbauregionen, die zudem von einer Vielzahl völlig eigenständiger Gegenden wie den Monte Lessini, den Colli Berici oder den mitten in der Po-Ebene aufragenden Vulkankegeln der Colli Euganei ergänzt werden. Rebsorten gibt es gut und gerne 50 verschiedene, wobei man es regionsabhängig mit lokalen, gelegentlich aber auch mit internationalen Varietäten zu tun bekommt.
1. Das Valpolicella
Geographie: Das Valpolicella hat vor gut fünf Jahrzehnten seine geographische Ausdehnung verdoppelt und der Region Hügel und Täler hinzugefügt, die in einer 2000-jährigen Weinbaugeschichte nie zu ihr gehörten. Angesichts der oft exzellenten Weine, die ihren Ursprung in den hinzugekommenen Weinbergen haben, scheint dieser Schritt absolut gerechtfertigt gewesen zu sein – auch wenn das Puristen und alteingesessene Familien der genuinen Zone bisweilen anders sehen.
Heute wird das Valpolicella also für gewöhnlich zweigeteilt: in das Valpolicella Classica und das Valpolicella Orientale. Im Westen trennt die Etsch die Region vom Bardolino, während im Osten das Valpolicella Orientale von der Weißweinregion Soave abgelöst wird.
Beide Subzonen werden von Tälern durchzogen, die hoch oben in den Monti Lessini beginnen und östlich von Verona quasi auf Meeresspiegelniveau enden. Entsprechend unterschiedlich sind die Weine, je nachdem ob man sich in den Weingärten in den Hügeln oder in der Ebene befindet. Auch wenn es lokale Unterschiede gibt, kann man pauschal sagen, dass die Geologie in den Bergen meist auf Kalk und Tuff beruht, während weiter unten der Tuff von Ton ersetzt wird.
Rebsorten: Das Valpolicella ist nicht nur aufgrund seiner Weinstile ganz eigenständig, auch seine Rebsorten sucht man woanders erstaunlicherweise vergebens – und das obwohl es auf den insgesamt 8500 Hektar Rebfläche eine ganze Menge davon gibt. Allen voran Corvina, die in so gut wie jeder Cuvée – und Cuvées sind es im Valpolicella eigentlich immer – den Protagonisten gibt. Ihr stehen prominent Corvinone, Rondinella und Oseleta zur Seite, weniger relevant sind (leider) Molinara, Dindarella, Forseleta und Spigamonte. Die Vielfalt ist enorm, der Spielraum für die Winzer ebenfalls. Wobei unisono die Meinung vorherrscht das Corvina die qualitativ spannendste und für Amarone geeignetste Rebsorte ist. Über den restlichen Rebsortenspiegel gehen die Meinungen oft erstaunlich weit auseinander.
Weinstile: Es sind vor allem die eigenwilligen Vinifizierungsmethoden, die dem Valpolicella eine Ausnahmeposition in Italien (und der Welt) garantieren. Nirgendwo sonst spielt man sich derart mit Trocknungsprozessen, nirgendwo sonst erzeugt man aus den getrockneten Trauben eine derartige Vielfalt an unterschiedlichen Stilen.
Der klassischen Valpolicella fällt aus diesem Rahmen. Er wird wie ein klassischer Rotwein produziert. Ihm fällt fast immer die Rolle des frischen, leichten und lebendigen Weins zu, der leider viel zu selten ernst genommen wird und abgesehen von einigen wenigen formidablen Ausnahmen (Monte dall’Ora legt mit seinen beiden Einzellagenabfüllungen Camporenzo und San Giorgio Alto diesbezüglich die Latte sehr hoch) meistens recht matt ausfällt.
Die Trauben für den Amarone werden stets vor dem Valpolicella und naheliegenderweise immer und ausnahmslos per Hand gelesen – verletzte Traubenschalen würden das appassimento, die Trocknung, verhindern. Frühgelesene Trauben besitzen eine hohe Säure, die als Kontrapunkt und Puffer zum – durch das appassimento – stets hohen Zuckergehalt eine eminente Bedeutung hat.
Die Gärung startet im Allgemeinen Ende Dezember, dauert für gewöhnlich einen Monat lang und endet dann, wenn die Hefen den kompletten Zucker in Alkohol verwandelt haben. Dass die Hefen dabei selbst Gradationen von bis zu 17 Prozent Alkohol wie nichts wegstecken, ist eine der erstaunlichen Phänomene des Amarone. Gereift wird Amarone in Holzfässern unterschiedlichster Größe und Provenienz: Eiche ist dabei nur eine Holzart unter vielen, man findet ähnlich oft auch Fässer aus Akazie, Kastanie oder Kirsche. Die Zeit im Fass beträgt meines Wissens mindestens zwei Jahre, bei den Reserven sind es zwei Jahre mehr.
Recioto war der einst große Wein des Valpolicella und wenn man den Quellen glauben darf, kelterten schon die Römer einen Weinstil, der dem Recioto ganz ähnlich gewesen sein dürfte. Recioto wird einen Monat länger getrocknet als Amarone und als Süßwein auf den Markt gebracht. Er erinnert frappant an exzellente Vintage Ports, wobei die Säure meist noch einen Tick höher ist. Er wird nur in mikroskopische Mengen vinifiziert und meistens zu Familienfesten in der Region getrunken. Der Rest bleibt Menschen vorbehalten, die sich auch für die Nischen der Weinwelt interessieren.
Die vierte Variante im stilistischen Potpourri des Valpolicella ist der Ripasso, der sich mittlerweile als die Nr. 2 in der qualitativen Wahrnehmung der Winzer und Konsumenten etabliert hat. Auch hier ist vor allem der Herstellungsprozess spannend. Nach vollendeter Gärung des Amarone oder Recioto und dem Umzug der Weine in Fässer bleibt der extrakt- und zuckerreiche Trester der konzentrierten – weil getrockneten – Beeren im Tank zurück. Um dem klassischen Valpolicella mehr Substanz zu verleihen, lässt man einen Teil davon eine zweite und wesentliche kürzere Gärung mit den Trestern durchmachen und schlägt damit eine Brücke zwischen den leichten und fruchtbetonten Valpolicellas und den oft mächtigen und intensiven Amarones.
2. Colli Euganei – Vulkane in der Ebene
Die Colli Euganei gehören anders als das Soave, Valpolicella oder Prosecco-Gebiet rund um Conegliano und Valdobbiadene zu den wenig bekannten Regionen des Veneto. Nachvollziehbar ist das nur bedingt. Zum einen liegen sie quasi im Herzen der Region – Padua befindet sich an den Ausläufern der Hügel, Verona und Venedig sind jeweils nur eine knappe Autostunde entfernt – zum anderen werden dort seit einiger Zeit Weine gekeltert, die zu den besten des Veneto gehören. Das hat vor allem mit der geologischen und topographischen Konstellation der Hügel zu tun, die selbst für die grundsätzlich heterogenen Landschaften des Veneto erstaunlich vielfältig sind.
Die Colli Euganei sind das Resultat vulkanischer Eruptionen, die sich vor ca. 30 Millionen Jahren ereigneten. Damals erhoben sich rund 50 Vulkane aus dem damals die Ebene bedeckenden Meer. Letzteres erklärt auch den Umstand, warum in tiefergelegenen Teilen der Hügel Kalk vorherrscht und man beim Wandern immer wieder auf Meeresfossilien stößt. Neben dem breitgefächerten geologischen Spektrum sorgen auch die topographischen Verwerfungen und die für das Veneto sehr warmen klimatischen Bedingungen für ein abwechslungsreiches und extrem eigenständiges Terroir.
Die spannendsten Weine der Hügel stammen von nördlich exponierten oder hoch gelegenen (vulkanischen) Weingärten, wo kühlere Luftmassen den Weinen ausreichend Struktur mit auf den Weg geben. Dank des Talents und dem Wissen vieler Winzer, finden sich aber auch aus tiefer gelegenen Lagen brillante Interpretationen. Und zwar in Rot und in Weiß und mitunter auch sprudelnd. Zwar bieten die Colli Euganei grundsätzlich ideale Voraussetzungen für stoffige und dichte Rotweinen, aufgrund des hohen Kalkanteils in vielen Weingärten haben aber auch Weißweine eine oft straffe wenngleich auch stoffige Struktur.
Die dominanten Rebsorten sind französischer Provenienz, was möglicherweise ein Grund für die zurückhaltende Rezeption der euganeischen Weine ist. Ohne autochthone Rebsorte tun sich selbst Regionen schwer, die auf ein einmaliges geologisches Fundament verweisen können. Wichtigste Rebsorte der Hügel ist Merlot. Und wo Merlot wurzelt, ist Cabernet Sauvignon selten weit. Cabernet Franc und Carmenere machen das Duo zu einem Quartett (wobei speziell Cabernet Franc beeindruckende Weine ergibt). Grund für die Dominanz Bordelaiser Sorten waren angeblich italienische Erntehelfer, die im 19. Jahrhundert Setzlinge der Sorten aus Frankreich in ihre Heimat mitbrachten. Einige der interessantesten Winzer der Region, allen voran Claudio und Nevio Scala und Filippo Gamba von Alla Costiera experimentieren seit einigen Jahren in Kooperation mit der Universität in Padua mit alten autochthonen Rebsorten wie Marzemina Nera Bastarda, Turchetta, Recantina, Corbinona, Pattaresca und Cavrara.
Weiß ist das Spektrum nationaler, wenn auch nicht lokaler geprägt. Garganega wird seit langem sehr erfolgreich angebaut und ist definitiv die Basis für die besten Weißweine der Colli. Exzellent schlägt sich in den Hügeln und speziell dort, wo es kalkig wird Moscato. Serprino könnte man zwar für eine autochthone Sorte halten, allerdings ist sie lediglich ein Synonym für Glera (Prosecco) und auch in den Hügeln Basis für Schaumweine. Tatsächlich ein Kind der Gegend ist Pinella, die jedoch nur in ein paar wenigen weißen Cuvées der Colli ihren Part spielen darf.